Donnerstag, Februar 06, 2020
Brexit: Was Einkäufer in der Übergangsphase tun sollten
Einkäufer sollten die Brexit-Übergangsphase nutzen, um Verträge zu checken und gegebenenfalls anzupassen.
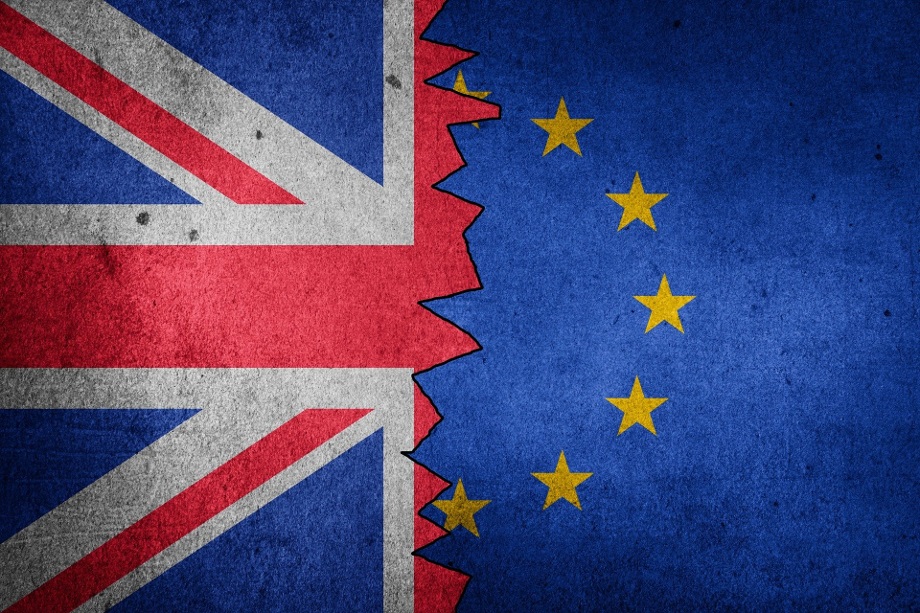
Einkäufer sollten die Brexit-Übergangsphase nutzen, um Verträge zu checken und gegebenenfalls anzupassen. Foto: Tumisu/Pixabay
Am 1. Februar ist das Vereinigte Königreich formell aus der Europäischen Union ausgetreten. Eine Übergangsphase bis Jahresende soll unmittelbare Veränderungen und somit Chaos verhindern. Einkäufer sollten diese Phase aber unbedingt nutzen, um sich „brexit-fest“ zu machen.
Jetzt ist er also doch noch gekommen, der Brexit. Zum 1. Februar 2020 hat das Vereinigte Königreich (UK) formell die Europäische Union verlassen. War bislang unklar, wann der Brexit wirklich kommt und zu welchen Bedingungen (hart oder weich), so wird das Bild durch den heutigen Austritt nun etwas klarer.
Die beruhigende Nachricht für deutsche Unternehmen mit britischen Geschäftsbeziehungen ist: Kurzfristig ändert sich erst mal wenig. Denn bis zum Ende der Übergangsphase – in der die beiden Parteien ihre weitere Zusammenarbeit klären wollen – läuft alles erst einmal so weiter wie bisher. Der Unionszollkodex samt entsprechender Durchführungsverordnungen gilt zumindest bis zum 31. Dezember 2020 unvermindert weiter.
Brexit: Jetzt Verträge aus der Schublade holen
Zwar ist ein Hard Brexit weiterhin nicht vom Tisch, doch dieses Szenario dürfte nun deutlich unwahrscheinlicher geworden sein. Dennoch sollten Unternehmen weiterhin vom Worst-Case-Szenario ausgehen und die Zeit bis zum Ende der Übergangsphase für einen „Brexit-Check“ ihrer Verträge nutzen.
„Ich rate Einkäufern, jetzt unbedingt ihre bestehenden Verträge mit britischen Lieferanten aus der Schublade zu holen und auf mögliche Risiken hin zu prüfen“, sagt Linda Lewis Rechtsanwältin bei der Kanzlei Kleymann, Karpenstein & Partner in Wetzlar und Expertin für anglo-amerikanisches Recht. Währungsfragen, Zölle, Exportbeschränkungen – all das könne die Wirtschaftlichkeit einer Geschäftsbeziehung schnell zunichtemachen, wenn man Verträge notfalls nicht kündigt oder neu verhandelt.
Die Expertin empfiehlt vor allem einen Blick auf die vereinbarte Incoterms-Klausel: „Ist DDP vereinbart, dann ist der Lieferant für die Verzollung zuständig. Bei EXW oder anderen Klauseln liegt die Verantwortung hingegen beim Einkäufer. Hier sollte man versuchen, neu zu verhandeln“, so Lewis. Auch die Frage, wer das Risiko einer verzögerten Lieferung aufgrund einer möglicherweise bevorstehenden Zollabfertigung an der Grenze trägt, sollte nun rasch geklärt werden.
Wegen Brexit Vorsicht bei Neuverträgen
Als noch wichtiger erachtet die Rechtsanwältin allerdings richtiges Verhalten bei Verträgen, die in der Übergangsphase neu geschlossen werden. „Auf jeden Fall sollte man eine Klausel aufnehmen, nach der nochmals nachverhandelt werden kann, wenn endgültige Klarheit über die neuen Beziehungen zwischen der EU und UK herrscht“, sagt Linda Lewis. Sie warnt davor, Verträge zu unterzeichnen, die der britische Vertragspartner hat vorbereiten lassen. „Viele dieser Verträge sehen ein einseitiges Kündigungsrecht für den britischen Lieferanten vor, wenn durch den Brexit die Konditionen für ihn schlechter werden und Nachverhandlungen scheitern“, weiß die Expertin.
Und sollte es eines Tages Zoff geben, so kann entscheidend sein, was unter „Gerichtsstand“ im Vertrag vereinbart wurde – auch darauf sollten Einkäufer bei Vertragsschluss jetzt besonders achten. Denn die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckbarkeit von Urteilen wird es nach Ablauf der Übergangsfrist nicht mehr geben. Zwar ist UK dem Haager Gerichtsstandsübereinkommen (HGÜ) beigetreten. Das heißt, eine Gerichtsstandsvereinbarung in Verträgen wird grundsätzlich anerkannt. „Aber die Vollstreckbarkeit eines Urteils ist nicht mehr gewährleistet“, sagt Linda Lewis. Sie rät dazu, sich keinesfalls auf einen Gerichtsstand in UK einzulassen oder britisches Recht zu akzeptieren. „Das kann im Prozessfall teuer werden“, so die Anwältin. Die Lösung könne ein Schiedsgericht sein, das sich „allerdings erst ab einem sechsstelligen Streitwert lohnt. Vorher ist es zu teuer.“
Zusätzliche Kosten von 500 Millionen Euro durch Brexit
Der Deutsche Zoll rät Unternehmen zudem in der Übergangsphase zu prüfen, inwieweit bestehende Bewilligungen angepasst werden können (z.B. Erweiterung des Länderkreises, Veredelungs- und Lagerorte in UK) oder neue zollrechtliche Bewilligungen zu beantragen sind, insbesondere die Bewilligung für den Betrieb eines Verwahrungslagers bei der Einfuhr von Waren. Zollanmelder müssen in der Regel in der EU ansässig sein.
Laut Deutschem Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sind es etwa 40.000 Unternehmen, die Waren aus UK importieren. Sie müssen sich eventuell auf komplizierte Zollanmeldungen einstellen. Insgesamt könnte der Brexit nach Schätzungen des DIHK mindestens 500 Millionen Euro Zusatzkosten für deutsche Firmen bedeuten.
Tobias Anslinger, BME